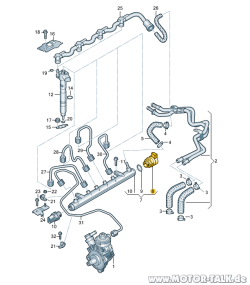Saturday ist, als hätte Virginia Woolf Mrs. Dalloway mit einem Skalpell in der Hand geschrieben. Wie dieses und das andere beste Buch aller Zeiten spielt sich die Handlung hier chronologisch innerhalb von etwa 24 Stunden ab, während die Begebenheiten aber vor allem Fenster öffnen für Erinnerungen und Reflexionen. McEwan ist allerdings kein Modernist, und so fließt sein Tag nicht wie aus einem Guss dahin, von Augenblick zu Augenblick mäandernd, er seziert den Tag vielmehr mit der intellektuellen Klinge seines Protagonisten, des Neurochirurgen Henry Perowne, der ein scharfer Beobachter und Analytiker mit gefestigten Einstellungen (und wenn nicht, weiß er zumindest sicher, dass er nichts weiß) und rationalen Reflexionen der eigenen Gefühle ist. So zerlegt McEwan den Tag in semantische Einheiten, in Begebenheiten, Zwischenmomente und Beobachtungen, beschreibt sie in Details und analysiert sie dann essayistisch, assoziativ, aber immer spürbar geplant, ohne willkürliche und endlose Ausschweifungen, vielmehr erhält jeder Gedanke, jede Meinung nur ein paar Zeilen Raum, bevor es zum nächsten Komplex oder Paradigma geht.

Durch den raschen Wechsel zwischen Themen bleibt so oft ein Gefühl der Unabgeschlossenheit und weniger ein bunter, reicher, aber abgerundeter Weltenkomplex, sondern eher eine Aneinanderreihung von Aphorismen. McEwan hakt seine Stationen und die Themenwelten, die sie anstoßen, geradezu lieblos ab, wie eine To-do-Liste. Man spürt keine Freude beim Lesen, keinen Spaß am Fabulieren und Erzählen, nur ein systematisches Abarbeiten, ein interpretierendes Zergliedern. Das Resultat ist eine holprige, wie spontan erdachte Erzählung, die nicht in sich rund und schlüssig wirkt, sondern wie ein Zwischenwerk, um alle überschüssigen Ideensplitter abzuladen und die Langeweile bis zum nächsten zündenden Romaneinfall zu überbrücken.
Dennoch wird dabei jeder noch so banale Moment mit Bedeutung aufgeladen, als ob er überzeitlich wichtig und einmalig wäre. Dadurch zerdehnen sich uninteressante Szenen ewig (wie das Racketballspiel), aber veranschaulichen zumindest gut das Leben im Moment, die unübertreffliche Bedeutung und das Gewicht, die jeder Moment hat, während man in ihm ist. Und nicht nur die Begebenheiten des Moments selbst sind auf diese Weise absolut, sondern auch die Gedanken an andere erlebte Momente. Momente sind das Leben.

Aber obwohl der Roman sich so realistisch, ja, materialistisch gibt, wenn er Gesichter und die kleinsten Handlungen genauestens darlegt, ist ausgerechnet seine Vorstellung vom Künstlerleben (das McEwan doch selbst kennt) sehr klischeehaft und unglaubwürdig. Der Großvater ist der launische, zurückgezogene Poet. Die Tochter liebt natürlich Jane Austen und andere Frauengeschichten, findet mit 13 über Jane Eyre die Liebe zur Literatur und kann als beinahe Unbekannte (aber eben Enkelin des großen Poeten) einen Gedichtband an den Verlag bringen. Und der Sohn ist ein verblüffend begabter Blues-Gitarrist, dem seine Karriere ebenso in den Schoß fällt. Diese Künstler bieten als Kontrastfläche zum Positivist und Poesie-Banausen Perowne natürlich auch Anlass zu allerlei Reflexion, beweisen aber vor allem die extreme Konstruiertheit des Universums von Saturday.

Denn zu viele außergewöhnliche Ereignisse prägen diesen als durchschnittlich verkauften Samstag, die dadurch einzeln genommen wenig langfristige Wirkung haben und nur dazu dienen, verschiedene Themenkomplexe anzustoßen. Selbst die für McEwan üblichen persönlichen Katastrophen demonstrieren viel weniger eindrücklich und schlüssig als sonst die Unumkehrbarkeit von Entscheidungen und Impulsen. Es ist alles ein bisschen wahllos, langweilig und banal.
Trotzdem konnten mich einige ziemlich elaborierte, durchdachte Beschreibungen, die oft den Kern typischer Gedanken und Empfindungen genau treffen, für sich einnehmen. McEwan ist eben ein scharfer Beobachter, kluger Deuter und gewandter Wortfinder. Aber wenig zu erzählen und viel zu sagen, das ist vielleicht die größte Kunst beim Schreiben, wie auch das ganze Leben in wenige Stunden zu kondensieren. Woolf und Joyce weiten dabei den Blick auf schlichtweg alles – alles Denkbare. McEwan begrenzt ihn auf seinen Neurochirurg und das kleine Gehirn eines Einzelnen.